Wohnen und Wohlbefinden im Alter
Eine psychologische Betrachtung
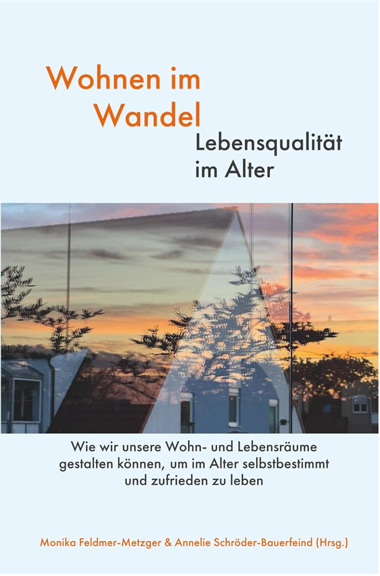
Dies ist mein Essay-Beitrag für das Buch: Wohnen im Wandel – Lebensqualität im Alter.
Wie wir unsere Wohn- und Lebensräume gestalten können, um im Alter selbstbestimmt und zufrieden zu leben. Herausgegeben von Monika Feldmer-Metzger und Annelie Schröder-Bauerfeind. Siehe auf dieser Website unter „Publikationen“.
Der Stand der Dinge
Die Alten werden immer älter und immer mehr. Laut den Daten des Statistischen Bundesamts sind 22 Prozent der Deutschen älter als 65 (Stand 2025). Das sind 19 Millionen Menschen, davon sind 2,7 Millionen sogenannte Hochbetagte, die älter als 85 sind. Dabei haben die heutigen Älteren nichts mehr gemein mit denen früherer Jahre. Die sogenannten Babyboomer (geboren 1950–1964), zu denen ich auch gehöre, stehen deshalb immer mehr im Fokus von Wissenschaft, Politik, Kultur, Medien und Wirtschaft. Tatsächlich nehmen wir maßgeblich am sozialen Leben teil, wir entscheiden Wahlen, sind einflussreiche Konsumentengruppen, wir bemühen uns um gesunde Ernährung und bleiben lange aktiv und beweglich – und: Wir bleiben noch gut 20 Jahre.
Aufgewachsen in einem hübschen 60-erJahre Architektenbungalow erlebe ich heute, wie meine Eltern und mit ihnen die meisten Bewohner solcher Eigenheime sich von ihren Stein-auf-Stein gebauten Nachkriegs-Träumen schweren Herzens verabschieden müssen – so auch meine Eltern. Die heute Hochbetagten sind überfordert mit der Pflege der oft dysfunktionalen, großen Anwesen, werden im hohen Alter selbst pflegebedürftig und haben sich darauf meist in keiner Weise vorbereitet. Denn der Umzug ins „Altenheim“ wird assoziiert mit den schlimmsten Vorstellungen und Vorurteilen. Aus der aktuellen Realität weiß ich, dass sich Seniorenheime in ihrer Qualität tatsächlich stark unterscheiden, aber auch ich hätte gern eine andere, l(i)ebenswerte Option für mein hohes Alter, denn wer sagt, dass ich mit 85 nicht mehr in meiner Küche tanzen will?
Heute werden wir erfreulicherweise später, anders und vor allem länger alt als frühere Generationen. Das bedeutet, wir könnten diesen langen Zeitraum aktiv selbst gestalten, um dem Wunsch nach hoher Lebensqualität zu entsprechen. Aus meiner Perspektive sieht es aber so aus, als würden negative Altersstereotypien immer noch dominieren, so als wäre das Bewusstsein für die Chancen dieser Entwicklungsphase noch nicht in unserem Denken, Fühlen und Handeln angekommen. Und damit meine ich nicht nur bei uns selbst, auch in der Politik, im Bauwesen und in der Architektur haben bislang die neuen Möglichkeiten und Herausforderungen des Alterns ein viel zu geringes Echo gefunden.
Ein entscheidender Aspekt für die angestrebte hohe Lebensqualität ist das Wohnen. Endlich sind im Rentenalter die eigenen vier Wände abbezahlt oder wir haben es uns in unserer langjährigen Mietwohnung gut eingerichtet machen wir es uns gemütlich auf der Couch und hoffen, dass es auch im hohen Alter so weitergehen wird. Die Häuser und Wohnungen, gleich ob zur Miete oder erworben, sind inzwischen zwar zu groß und entsprechen nicht mehr unseren Wohnbedürfnissen im Alter – aber wir sitzen es aus.
Das entspricht nicht dem Bild vom Altern, das die aktuelle psychologische Forschung zeichnet. Die Neue Alternspsychologie (NAP) weist nach, wie wichtig unsere eigenen Bewertungen und Einstellung zum Altern für den Lebensverlauf und sogar für die Länge des Lebens sind. Insbesondere für die psychischen Herausforderungen des hohen Alters ab 80 brauchen wir ganz neue Bewältigungskompetenzen. Je besser wir über die Jahre jenseits unseres 60. Geburtstages informiert sind – ggf. sind das mehr als 20 Jahre – umso leichter sollte ein selbstbestimmtes und bewusstes Leben und Wohnen möglich sein.
Die aktuellen Erkenntnisse der NAP zeigen ein neues Bild vom Altern
Alte Menschen sind verschieden und in den unzähligen Formen des Älterwerdens spiegeln sich vielfältige Bedürfnisse wider: Besonders im jungen Alter zwischen 60 und 80 können wir mehr Zeit genießen, Freiräume auskosten, neue Lebenserfahrungen machen. Dieses Alter ist eine Entwicklungsphase mit vielen Möglichkeiten und Chancen und keineswegs nur kognitiver Abbau, sozialer Rückzug und Warten auf den Tod. Vom hohen Alter wissen wir noch nicht genau, wie sich diese Lebenssituation psychisch auf uns auswirkt, denn hier kommen neue (gesundheitliche) Risiken ins Spiel.
Altern beginnt im Kopf: „Wir sind so alt wie wir uns fühlen“ ist von hoher Bedeutung. Menschliches Altern wird von uns interpretiert und unsere subjektiven Bewertungen haben entscheidenden Einfluss auf unsere körperlichen und kognitiven Funktionen.
Gleichzeitig zeigt die Plastizität unseres Gehirns (das Potential des Gehirns, sich zeitlebens verändern und anpassen zu können) und unser Gestaltungsfreiraum, dass wir aktiv unseren Alterungsprozess mitgestalten können.

Was heißt Wohlbefinden im Alter?
Eine zentrale Erkenntnis der NAP weist nach, dass ältere Menschen über sinnvolle Tools verfügen, um ihr Wohlbefinden aufrechtzuerhalten und um mit den Schwierigkeiten des Älterwerdens gut zurecht zu kommen. Ebenso wächst die Akzeptanz, das Annehmen und Sich-arrangieren mit Dingen, die nicht mehr zu ändern sind. Wir werden auch besser darin, Dinge, Aktivitäten und Menschen auszuwählen, die uns guttun und anderes loszulassen. Und wir werden besser im Kompensieren von Schwächen. Das heißt, trotz zunehmender Verlusterfahrungen und abnehmender Selbständigkeit bleibt das kognitive und emotionale Wohlbefinden relativ stabil, denn ältere Menschen nutzen ein ganzes Set von Strategien zur Stabilisierung ihres Wohlbefindens. Man spricht vom „Positivitätseffekt“ des Alters, der auf neurobiologischen Grundlagen beruht.
Auch zahlt sich im hohen Alter langjährige, regelmäßige körperliche Aktivität aus, denn sie geht dann einher mit besserer kognitiver Leistungsfähigkeit und einer kürzeren und weniger schweren Pflegebedürftigkeit im hohen Alter. Ältere, die sich subjektiv jünger erleben, berichten über ein höheres psychisches Wohlbefinden und sie verfügen darüber hinaus über einen gesünderen und aktiveren Lebensstil.
Soziale Beziehungen im Alter
Das menschliche Grundbedürfnis nach sozialen Beziehungen zeigt sich bis ins hohe Alter. Insbesondere nahe und intime Kontakte (auch Paarbeziehungen) werden von alten Menschen engagiert gepflegt. Die Tatsache, dass im Alter unser soziales Netzwerk kleiner wird, hat nach der SST (Sozio-emotionale Selektivitätstheorie) keineswegs mit Rückzug zu tun, sondern mit unserer Intention, bei einer verkürzten Zukunftsperspektive gar nicht mehr so viele Sozialkontakte zu wollen.
Beim Thema Einsamkeit wird oft behauptet, sie sei das größte Problem des Alters. Dabei gibt es nur einen moderaten Anstieg an Einsamkeit im Alter, besonders bei Frauen. Richtig ist, dass emotionale Erfahrungen wie menschliche Nähe, Intimität und Vertrauen im Alter in den Vordergrund rücken und wir dann lieber in den Erhalt weniger wichtiger und enger Beziehungen investieren.
An dieser Stelle soll nicht das falsche Bild entstehen, dass alles rosarot wäre. Unsere Fragilität und Verletzlichkeit gehören im hohen Alter dazu, Pflegebedürftigkeit eines oder beider Partner müssen ausgehalten werden, Trennungen im höheren Alter sind inzwischen nicht mehr selten, Freunde und gute Nachbarn sterben oder ziehen weg und schließlich führen schwierige Wohnverhältnisse häufig zu hohem Einsamkeitserleben.
Die Rolle des WOHNENS für das Wohlbefinden im Alter
Die individuelle Entwicklung ist immer in soziale, sachliche und räumliche Zusammenhänge eingebunden. Deshalb erweisen sich soziale Interaktionspartner und die Wohnung im Alter als unverzichtbare Ressource. Leider steckt die Forschung zum Thema Wohnen im Alter noch in den Kinderschuhen. Dabei sind Häuser und Wohnungen von alten Menschen für deren Lebensqualität sehr bedeutend, weil Altern vor allem dort geschieht. Wir verbringen im Schnitt heutzutage ca. 90 Prozent unserer Zeit in Innenräumen, alte Menschen noch deutlich mehr. Ältere verbinden kognitiv und emotional sehr Vieles mit den eigenen vier Wänden – sie leben oft seit Jahrzehnten dort, fühlen sich daheim, erleben sie als Kraftquelle und wollen dort auch bleiben. Ältere Menschen haben also ein besonders enges Verhältnis zu ihrem Wohnumfeld. Am Wohnen im privaten Haushalt machen sich Selbständigkeit und Autonomie fest. Wohnen und besonders der Wohnraum sind Ausdruck individueller Aneignungsmöglichkeiten sowie der eigenen Identität. „Wohnungen verpetzen uns“, bezeichnete Gabriele von Arnim diesen Sachverhalt.
Außerdem ändern sich mit dem Älterwerden die Lebensumstände und die Wahrnehmung der eigenen Identität. Viele ältere Menschen legen dann großen Wert auf ein Zuhause, das Sicherheit, Geborgenheit und Unabhängigkeit bietet. Eine stimmige Wohnumgebung kann das Gefühl der Selbständigkeit fördern und sozialer Isolation entgegenwirken. Barrierefreies Wohnen, Zugang zu Gemeinschaftseinrichtungen, soziale Kontakte sind nur einige wichtige Faktoren, die die Lebensqualität älterer Menschen beeinflussen. Denn eine selbstbestimmte Lebensgestaltung, das Gefühl von Selbstwirksamkeit (schwierige Herausforderungen aus eigener Kraft bewältigen zu können), Kreativität und eine aktive Lebensgestaltung haben großen Einfluss auf unseren Alterungsprozess. Wohnräume sollten bestenfalls dann nicht nur funktional, sondern auch emotional ansprechend gestaltet sein. Das richtige Licht, ansprechende Farben, stimmiges Mobiliar, angenehme Materialien und persönliche Gegenstände rufen positive Erinnerungen wach und unterstützen das Wohlbefinden.
Dabei hängen subjektive Momente des Wohnens (die Bewertung und Verbundenheit mit der Wohnung) und objektive Wohnmerkmale und was sie mit den älteren Menschen machen zusammen mit zentralen psychologischen Bedürfnissen der Bewohnenden, mit Identität und Autonomie. Beide sind eng verbunden mit dem persönlichen Wohlbefinden und beide gehen einher mit der eigenen Lebensgeschichte und Wohnbiographie: Wie und wo habe ich früher gewohnt? Was war mir daran wichtig? Wie hat sich das Wohnen im Laufe meines Lebens entwickelt?
Die Wohnzufriedenheit ist stark gekoppelt mit der Ortsidentität: In der Wohnung finden sehr bedeutende emotionale Ereignisse statt, die an diesen Ort binden und Verhaltensweisen und Bedeutung für das Leben generieren. Wir erhalten dadurch ein Gefühl der Zugehörigkeit, das die Wohnzufriedenheit positiv beeinflusst. Weitere Einflussfaktoren für Wohnzufriedenheit und Wohlbefinden sind z.B. nachbarschaftliche Beziehungen sowie das Angebot an Infrastruktur und Dienstleistungen.
Wenn Wohnungen die Autonomie einschränken, z. B. durch Barrieren, fehlende Fahrstühle, zu enge Verkehrswege, nicht altersgerechte Bäder, schlechte Beleuchtung etc., hat das bedeutende psychologische Folgen, wie Wahl et al. in einer Studie (2009) zeigen konnten. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass eine altersgerecht geplante und eingerichtete Wohnung die Autonomie fördert. Doch halten wir uns mit entsprechenden Anpassungen unseres Wohnraums noch zu sehr und zu lange zurück – sofern wir sie überhaupt in Erwägung ziehen. Laut Wahl geht es um „Ängste vor Umbauschmutz (doch dieser hält sich oft in Grenzen), schlechte Informiertheit (hier haben die Kommunen eine wichtige Aufgabe), Bedenken wegen der Kosten (diese sind aber oftmals gar nicht so hoch und Zuschüsse, etwa über die Pflegeversicherung, sind möglich) und nicht selten auch negative Altersbilder (Das lohnt sich doch für mich nicht mehr).“ (Wahl, 2017. S 123)
Erleben sich Ältere aber als Gestalter von Wohnungen und sehen viele Handlungsräume und Entfaltungsmöglichkeiten in ihrem Wohnumfeld, zeigen Sie höhere Autonomie, ein höheres kognitives und affektives Wohlbefinden sowie eine geringere Depressivität – so eine große europäische Studie an über 80-jährigen Personen (Oswald et al. 2007). Diese Zusammenhänge zeigten sich in unterschiedlichen Ländern. Doch ist für ca. 20 Prozent der über 80-jährigen und sogar 40 Prozent der über neunzigjährigen der Umzug ins Pflegeheim unvermeidbar. Diese Umsiedlung („Ein alter Baum lässt sich nicht verpflanzen“, „Mein Haus verlasse ich nur mit den Füßen voraus“…) wird oft als sehr schmerzlich erlebt und bei unserer Elterngeneration nehme ich wahr, dass sie sorgfältig verdrängt wurde und heute noch wird. Es sollte nicht unbedingt das Pflegeheim sein müssen, aber trotz der historisch neuen Leistungsfähigkeit der coolen Boomer wird eine letzte Phase der Hilfe- und Pflegebedürftigkeit kommen.
Aus den Studien zur Stressbewältigung wissen wir, dass es eine lohnende Vorbereitung und eine gute Investition ist, sich mit einer großen Anforderung frühzeitig auseinanderzusetzen und auf diese Weise ein Stück Kontrolle zu behalten. Und hier sind wir bei einer der Grundbotschaften der NAPS: Das Gefühl der Kontrolle gehört zu den Fundamentalbedürfnissen des Menschen. Die Erfüllung dieses Bedürfnisses führt zu höherem Wohlbefinden, zu höherer Zufriedenheit, zu einer besseren Anpassung an Neues, zum längeren Erhalt der Selbstständigkeit und zu besserer Gesundheit.
Deshalb wäre es schon früh- und damit rechtzeitig sinnvoll, sich ganz besonders gut über Wohnalternativen im Alter zu informieren. Viele Lebensentscheidungen wägen wir lange ab und holen detaillierte Informationen ein, aber in welcher Pflegesituation wir unsere letzte, kostbare Zeit verbringen wollen interessiert die meisten von uns noch zu wenig.
Im Zuge dessen muss sich der Wohnungsmarkt zukünftig viel deutlicher an den Wünschen und Bedürfnissen alternder Menschen orientieren. Einige Beispiele für neue Wohnformen, wie Haus- und Wohngemeinschaften, von Kommunen organisierte Tauschmöglichkeiten von Wohnraum, gemeinschaftliche Wohnformen, Mehrgenerationenwohnen, Seniorendörfer, Betreutes Wohnen etc. werden an anderer Stelle in diesem Buch beschrieben.
Für das Wohlbefinden im Alter spielt also das Wohnen eine entscheidende Rolle. Eine stimmige Wohnumgebung kann das Gefühl der Selbständigkeit fördern und sozialer Isolation entgegenwirken. Barrierefreies Wohnen, Zugang zu Gemeinschaftseinrichtungen, die Möglichkeit, in bekannter Umgebung zu bleiben sind wichtige Faktoren, die auf Lebensqualität und Lebensfreude älterer Menschen erheblichen Einfluss haben.
Die gesellschaftspolitische Perspektive
„Ageing in Place“ lautet der Anspruch und bedeutet, so lange wie möglich selbstbestimmt und eigenverantwortlich in vertrauter Umgebung (das muss nicht die eigene Wohnung sein) zu altern. Die Berliner Körber Stiftung zeigt in einer Studie von 2022, wie Kommunen gutes Wohnen im Alter ermöglichen können. Zwar gehen etwa 50 Prozent der sogenannten Boomer mit Wohneigentum in die Rente und die zur Miete wohnen, zahlen vergleichsweise wenig für ihre Wohnungen, aber der Wohnraum ist meist nicht fürs Älterwerden ausgelegt. Generell wohnen ältere Jahrgänge auf deutlich mehr Quadratmetern als Jüngere. Wären angemessene Optionen zum Wohnen im Alter vorhanden, könnte viel Wohnfläche frei werden, die von jüngeren Menschen händeringend gesucht wird. Kommunen sollten sich mit alternativen Wohnformen vertraut machen, wie Alters-WGs und Mehrgenerationenhäuser, wobei Pflege- und Unterstützungsangebote immer mitgedacht werden müssen.
Eine Wohnungsbau-Sozial-Studie des Prestel Instituts „Wohnen im Alter“ bilanziert, dass der Wohnungsmarkt in keiner Weise auf die geburtenstarken Jahrgänge vorbereitet ist. Schon heute fehlen demnach rund 2,2 Millionen altersgerechte Wohnungen. Den politischen Umgang mit dieser „grauen Wohnungsnot“ nennt der Leiter des Prestel Instituts, M. Günther, „Vogel-Strauß-Taktik“, denn dass es diese Wohnungen geben wird, sei aus heutiger Sicht reines Wunschdenken. Außerdem, so die Studie, werden sich zwei Drittel der Älteren, die in Mietwohnungen lebten, einschränken müssen, weil die Renten nicht mehr ausreichten. Hier wird also sehr oft der Staat einspringen müssen.
Die Lösung: mehr Umbau und mehr Neubau für altersgerechtes Wohnen mit Zuschüssen für selbstgenutztes Wohneigentum und Förderprogramme für die Aufteilung von Ein- und Zweifamilienhäusern. Denn das Altenheim am Rand der Stadt hat ausgedient, es braucht keine speziellen Institutionen und Zentren für Alte. Stattdessen wären ganz normale Siedlungen und Quartiere wünschenswert, mit Wohnungen, die auch für alte Menschen tauglich sind, mit flexiblen Pflege- und Dienstleistungsoptionen für die Betreuung und Unterstützung Hochbetagter.
Die persönliche Perspektive – art of aging
Die Lebensentwürfe der Älteren sind bunt gemischt. Zudem starten wir mit einem neuen Selbstverständnis ins Rentenalter. Wir sollten dieses Momentum nutzen und jetzt beginnen, uns Gedanken zu machen und Vorkehrungen zu treffen, wie beispielsweise konsequent in präventive Maßnahmen im Wohnbereich zu investieren.
Dabei sind die Berücksichtigung psychologischer Aspekte und der Wohnbedürfnisse des Alterns bei der Wohnraumgestaltung von großer Bedeutung für ein erfülltes und zufriedenes Leben im Alter. Allerdings bedarf es Achtsamkeit, Engagement und Umdenken von uns Älteren und nicht ein Sich-Ausruhen im Status Quo. Es geht schließlich nicht nur um erfolgreiches Altern und stimmiges Wohnen, sondern auch um ein „erfolgreiches Sterben“. Das Leben auch vom Ende her zu betrachten scheint vielleicht zunächst fremd, aber sollten wir uns nicht ernsthaft mehr dafür engagieren, auch unsere letzte Zeit (mit) zu gestalten?
Letztlich geht es bei diesem so wichtigen Thema um unsere Einstellung zum Leben: Vielleicht sollten wir den Blick mehr auf die Chancen richten als auf Verluste. In geistiger, körperlicher und emotionaler Hinsicht geht es hierbei auch um das Loslassen, damit Raum für Neues entstehen kann. Bleiben wir aktiv und zuversichtlich. Ich finde, so geht Lebenskunst.
Sie sind auch fortgeschrittenen Alter und machen sich Gedanken um ihre aktuelle und zukünftige Wohnsituation? Ich bin an Ihrer Seite, wenn es darum geht, sich klar zu werden, was Ihre jetzigen Wohnbedürfnisse sind und ich unterstütze Sie dabei, ggf. gute Entscheidungen für eine rosarote Wohnzukunft zu treffen. Nehmen Sie Kontakt zu mir auf – tatsächlich sitzen wir im gleichen Boot.
Literatur
Oswald F. et al. (2007): Relationships between housing and healthy aging in very old age, in: The Gerontologist, 47, S. 96–107.
Wahl, H.-W. (2017): Die neue Psychologie des Alterns. Kösel-Verlag, München
Wahl, H.-W., Fänge, A., Oswald, F., Gitlin, L.N. & Iwarsson, S. (2009): The home environment and disability-related outcomes in aging individuals: What is the empirical evidence?, in: The Gerontologist, 49, S. 355–367.
Wahl, H.-W. & Oswald, F. (2016): Theories of environmental gerontology: Old and new avenues for ecological views of aging, in: V.L. Bengtson & R. Settersten, R.A. (Hrsg.), Handbook of theories of aging. 3. Auflage, New York, Springer, S. 621–641.